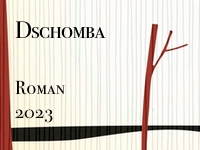Rattifizierung, Schlangengelingele
16/03/2017
„Man müsse der beständigen Verwolfung deutlich entgegentreten. Der fremde Mann klopfte das Gesagte in den Tisch, es schien, er klopfte so den billig weiß beschichteten Esstisch hinein in einen anderen Zustand, vernarbtes Vollholz wuchs unter seinen Fingerknöcheln, bei jedem Klopfen ein wenig mehr. Unter dem Staunen der Kinder die – husch husch – weggeschickt worden waren. Ins Bett? So früh? Alle?“
Beginn meiner Erzählung Verwolfung. Der ganze Text ist ist frisch erschienen – in der aktuellen Ausgabe von Literatur und Kritik (März 2017, Nr. 511/512).
Watschenmann (Textauszug)
25/02/2013
Kein Rabe für Heinrich. Die ersten zwei Regeln. Vielleicht auch die dritte.
An einen Raben will er denken, an einen, der sich gegen den Wind stemmt. Lydia meint, das steht ihm nicht zu, das taugt nix. „Warum?“ „Der Rabe ist zu hoch für dich, zu schön.“ Heinrich versteht nicht gleich. „Wirst schon verstehen“, sagt sie, sagt oft solche Sachen und erklärt sie dann nicht. „An was denkst du, Lydia, wenn du geschlagen wirst?“ Statt einer Antwort spuckt sie vor seine Beine. „Wirst wohl aufhören mit der Fragerei. Wochenlang redest nix, und dann.“
Heinrich weiß schon, dass es schwer ist am Anfang. Du wartest auf den Schlag, auf den Tritt gegen Arm oder Bein. Und weil du wartest, weil alles bereit ist, alle Nerven, weil die Haut sich hindehnt und die Synapsen im Kopf flimmern und zucken, weil das so ist, blitzt es. Wenn sich der Stiefel ins Schienbein bohrt. Oder der Absatz von Damenschuhen in die Rippen. Auch das gibt’s. Dann blitzt es vor den Augen, du gehst in die Knie, windest dich auf dem Boden. Wie ein Wurm, zwischen Hundehaufen und Mist. Windest dich und stöhnst. Oder wimmerst. Noch schlimmer. Dann treten sie stärker, damit du aufhörst. Das hat keine Logik. Und weil es keine hat, hat es eine.
„Da capo!“ Lydia kreischt vor Lachen, hässlich ist sie, als sie es Dragan erzählt. Da liegt einer auf dem Boden und bittet höflich, noch einmal hinzutreten. Heinrich hasst sie in dem Moment. Na, weil sie Recht hat. Daher auch das Humpeln. Zuviel Zugabe bekommen. Klappe nicht halten können. So schaut’s aus.
Also kein Rabe. Über dem Sturm, nein, über dem Platz. Heinrich hat da so einen Vogel gesehen, kurz vor dem Sturm. Er flog über den Platz, die Bäume griffen in der Luft herum. Die war voller Staub und Sand, von der Baustelle beim Schottenring, wo sie das Hochhaus vom Boltenstern hinstellen. Am Sonntag gehen die Familien Bagger und Baugrube schauen. Die Büro-Väter erklären Bewehrungen und Verstrebungen, und die Hausfrauen-Mütter nicken und sagen, man solle aufpassen, was der Vati erzählt. Und sich nicht schmutzig machen am Bauzaun. Danach gibt es ein Eis am Schwedenplatz. Schöne neue Welt.
Der Vogel flog gegen den Wind. Er stemmte sich quer über die Leute, die ihre Kinder und Taschen packten und gingen, aber Heinrich blieb sitzen und sah dem Raben zu. Weil der so aussah, als würde er schwitzen. Das waren nur seine Federn, die glänzten blauschwarz.
„Warum soll der Junge nicht an einen Raben denken, Lydia? Ein Rabe ist so gut wie jedes andere Tier.“ Dragan zeichnet mit seinem Stock Linien in Lydias Spucke. Dann steht er auf, putzt sich den Dreck von der Jacke, gähnt. „Ich bin hungrig“, sagt er. „Woran denkst du, Dragan, wenn man dich schlägt?“ Dragan sieht ihn an, die hellen Haare, das schmale Kinn. „Hm. An meine Eier, wenn es den Kopf erwischt. An den linken Daumen, wenn es die rechte Hand treffen wird. Wenn sie mir in den Arsch treten, denke ich an dich, psiću.“ Psiću. Kleiner Hund. Er lacht. Und geht. Abgang, Abmarsch. Weg. „Pazzo“, murmelt Lydia.
Lydia und Dragan. Das ist so eine Sache. Seit Heinrich mit ihnen durch die Stadt zieht, denkt er über sie nach. Was er halt nachdenken nennt. In seinem Nachdenken sind die beiden ein Paar. Sind Mutter und Sohn. Sind gar nichts. Lydia war zuerst da. Heinrich ist in ihr Versteck gestolpert, wäre ihr fast in die Arme gefallen. Versteck darf er nicht sagen. Dragan meint, es ist anders rum. „Draußen versteckt sich die Welt vor uns.“ Wie er uns gesagt hat, hat Heinrich gewusst, er meint ihn auch. Und ist geblieben. Dragan nennt den Verschlag palata. Lydia sagt, es wäre nicht mehr als eine Bruchbude, eine versaute Dreckshöhle, ein paar Bretter hinter einer leeren Werkstatt. Wahrscheinlich war das früher ein Schuppen. Wahrscheinlich ist der Schuster tot. Zerschossen. Oder bei den Russen. Dem Jungen ist das gleich. Es ist ruhig und trocken. Mehr braucht man nicht.
Die Werkstatt ist versperrt. Heinrich presst die Nase so fest an das Glas, dass es knackt. Brich, denkt er, brich einfach. Dann komme ich rein in deine Zeit. Lydia erwischt ihn vor den Fenstern. „Verschwinde“, schimpft sie, „das gehört dir nicht.“ Dass das niemanden mehr gehört, ist ihr egal. Dann gehört es sich selbst. Lydia, könnte er sagen, ich tu‘ doch nichts. Ich nehm‘ keinem etwas weg. Aber er schweigt. Er wartet, bis sie mit dem Stock droht. Bis sie damit auf seine Beine drischt. Bis sie ihn fortschwemmt mit ihren Flüchen. Dragan hat viele Namen für Lydia. Dušo moja. Meine Seele. Ljubavi. Liebste. Srećo moja. Mein Glück. Vielleicht sind sie ja doch ein Paar.
(Siegertext beim LiteraturPreis Wartholz 2013 – Kapitel 1 und 2 des Watschenmannes auf Schloss Wartholz/Siegertexte)
Im dunklen Zimmer. Es ist nach Mitternacht, nur der Bildschirm leuchtet. Ich stelle seine Helligkeit so niedrig wie möglich und denke an C.
C. lebt in Florida. Ich habe ein Bild von ihm. Es zeigt einen schmalen Burschen, in Uniform, 1945. Er erzählt mir oft vom Krieg, von Österreich im Krieg, von den Mädchen, von „Ankerbrot mit Schmalz und Salz“ – er sagt „Schmohlts und Sohlts“, er sagt „servus“ und „kapuut“ und „macht nix“. Ich habe ihm zum Geburtstag ein Wörterbuch geschickt, in die Karte geschrieben: Next time I’m with you we’ll talk German all day long.
Sein Körper ist schwer geworden. Er schleppt ihn durch die Wohnung. Manchmal ist C. so traurig, dass er wütend wird. Dann entlädt sich ein Funken seiner früheren Kraft. Etwas blitzt auf, schleudert sich in die Luft und verbirgt sich im nächsten Moment. Auf dem linken Unterarm trägt er ein Anker-Tattoo.
Dieser Anker rührt mich am meisten an.
Wir unterhalten uns oft per Skype. Einmal summte C. eine Melodie. Do you know this song? Ich schickte ihm einen Link, sah, wie er das Mail öffnete, hörte mit ihm „Lili Marleen“, sah sein Gesicht nicht mehr im Bildschirmfenster der Webcam, nur die weißen Haare, er hielt den Kopf gesenkt, ganz dicht an den Lautsprechern seines Computers. Der Kopf zuckte. You made me cry.
Deswegen muss ich das jetzt schreiben, in der Nacht, aus der ich C. nicht helfen kann. Ich stehe am Eingang und er entgleitet mir an ihrem Ende. Ich stehe am Eingang und halte eine Leinwand hoch, auf die er sein Leben wirft, dessen Dauer er spürt und die Fülle und alle Farben und Gerüche und alles Licht und die Bewegungen und Berührungen, seine Männlichkeit, seine Souveränität, all das.
All das muss ich festhalten wie auf einer Leinwand, und wenn die Arme schon wehtun, muss ich sie trotzdem noch halten, und wenn er weint, dann darf ich die Arme nicht sinken lassen, sondern muss sagen: Schau hin.
Die Frau des Schneckenkönigs (Textauszug)
18/06/2012
Natürlich wird dieser Text meinen Eltern vorgelegt werden. Mit einem dieser speziellen Begleitschreiben, bei dessen Formulierung sich nicht feststellen lässt, was überwiegt: Empörung oder Besorgnis? Soll das Kind bestraft werden oder behandelt? Da Strafe Annäherung bedeuten würde, werden sie für die Behandlung plädieren. Wie auch immer.
Nackt, bis auf das Tuch über meinen Schultern und den Spuren auf Bauch und Schoß, sitze ich an dieser Arbeit für Biologie und das, was man in unserer Schule Ethikunterricht nennt. Es ist halb vier Uhr früh, ein Vogel singt schon im Baum vor dem Fenster. Ich muss es schließen, damit er nicht hereinfliegt, den Schneckenkönig stiehlt und sein Fleisch aus dem Gehäuse zieht. Dieses Gehäuse ist linksgängig, normale Schneckenhäuser winden sich nach rechts. Lange Zeit habe ich einen der sehr seltenen Schneckenkönige – so nennt man sie tatsächlich – gesucht. (Das erklärt auch meine zahlreichen Bitten um Fristverlängerung und die Tränen, wenn man sie mir nicht genehmigen wollte.)
In dem Moment, in dem ich diese Zeilen tippe, streckt der Schneckenkönig seine Fühler aus. Er ist außergewöhnlich lang, fast elf Zentimeter und laut Vorbesitzer sechs Jahre alt. Als ob man ihn besitzen könnte. In Wahrheit wird man von ihm besessen, im Wortsinn. Ich habe mich von ihm besitzen lassen, und davon handelt dieser Essay.
Auszug aus dem Text „Die Frau des Schneckenkönigs“ (c) Peschka.
STERNTALER (Textauszug)
19/03/2010
Ich stelle mir den Tod vor, er bildet sich zwischen den Büschen, eine Gestalt aus wirbelndem Sand. Was weiß ich über ihn?
Nichts, er ist nur das zerbrechende Geräusch in der Lunge meiner Großmutter, die in meinen Armen starb, als ich ein Kind war, staunend. Er ist die plötzliche Abwesenheit von Leben, die sich sofort mit neuem Leben füllt, ein Flicken neues Leben über der abgestorbenen Stelle. Ja, aber was weiß ich über den Tod? Nichts. Also verhandle ich mit ihm, nenne ihn Hades, beschwöre ihn, frage: Warum bist du Hades, warum nicht Narkos, dein Bruder, der Schlaf bringt statt Tod?
Was willst du, um ihn freizugeben?
Meine Seele ist leer. Alles, was zu sagen ist, ist gesagt. Bis auf ein Letztes. Während du dich immer weiter von mir entfernst, starrt Hades in meine Richtung, über mich hinweg, als warte er auf etwas, auf das Letzte. Und indem mich die Worte verlassen, kommt auch dieses Letzte nach oben: Was, wenn ich an seiner Stelle sterbe?
Ein Ruck in den Augen des Todes, jetzt sieht er mich an und ich spüre, ja, das wäre die Wahrheit, denn auch das spüre ich: Sie darf es nicht sein. Du stellst dich zwischen mich und den Tod. Wehrst ihn ab. Ein Blick von dir und er wird im Wind zerblasen, Staubteilchen verfangen sich in meinem Haar, feiner Staub, der mich nie verlassen wird.
Aber du sagst: Nein.
Du bist tot. Unwiderruflich. Sand wirbelt um uns, der Wind spielt mit trockenen Blättern.Etwas senkt sich in mir. Sinkt nach unten. Das Licht senkt sich, wird dunkler um einen Ton. Das Hellblau des Himmels färbt sich ins Purpurne. Der Himmel senkt sich auf die Sträucher, verbirgt sie.
Mein Denken sinkt, mein Fühlen, meine Hände sind schwer, mein Kopf senkt sich, meine Schultern. Es, was, zieht mich nach unten, du stehst vor mir, siehst mich an. Ich falle auf die Knie. In dieser beginnenden Dunkelheit, die still ist wie ein Meer. Ein Meer aus Sand.
Hedwig in der Nische (Textauszug)
15/10/2009
Hedwig sah sich in der Nische um. Die war einen halben Meter tief. Zwei Meter hoch und einen Meter breit. Nicht viel Platz. Aber wenn man eine alte Matratze zusammenrollt? Dachte Hedwig. Und im Winter könnte man eine Plastikplane vorhängen. Dann gäbe es sicher bereits Leute, die sich meiner erbarmen. Und Essen bringen. Und sich wohl dabei fühlen. Barmherzig. Ich würde anderen helfen, barmherzig zu sein. Ich würde schon riechen und die Grätze haben und verwässerte Augen, weil ich trinken müsste, um das hier auszuhalten, und schwarze Zahnstummel in einem verrunzelten Mund. Ich würde alte Kleider anhaben und dicke Strümpfe und nur mehr einen Meter fünfzig groß sein, mit verfilztem grauen Haar auf dem Kopf und so unverständlich brabbeln, dass mich niemand mehr versteht. Wie schnell das geht, dass man verfilzt, dachte Hedwig.
Sie sah auf. Die nächste Straßenbahn kam. Hielt. Fuhr weiter. Eine Frau ging vorbei. Sie führte ein Hündchen an der Leine und roch nach Blumen und Zimt. Hedwig sah sich klein und verhunzelt in der Nische hocken, während ein Hund das Bein hob. Verflixte Köter, dachte Hedwig. Und: Man könnte sich hier ja auch was Grünes anschaffen. Efeu, zum Beispiel. Der rankte sich dann rund um den Eingang. Ein neues Bild zwirbelte sich in Hedwigs Kopf zusammen: Hedwig in der Nische, die von Blumen umrankt war. Wie ein altes Heiligenbild. Im Winter wäre sie barfuß, wie die Heilige Hedwig von Andechs. Omas Lieblingsheilige. Daher der Name.
Auszug aus dem Text „Hedwig in der Nische“ – Bild von Nicola Dander.