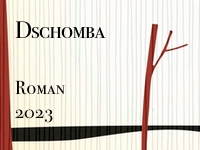Stodertal, Ewigschatten
04/08/2010
Im Schweigeraum des Vaters
Gegenüber hockt eine Taube im Abendlicht gerade so hinter der Dachkante, dass nur ihr gedrungener Oberkörper zu sehen ist. Sofern Tauben Oberkörper haben. Sie sieht sich die pfeiligen Schwalben an, folgt ihnen mit Kopf und Schnabel. Drei Äpfel liegen neben mir auf der Holzbank, erst dachte ich, sie wären so duftig, dann war es doch der ganze Garten. Ob die Tauben hier weniger grauslich sind als in Wien? Gegenüber, am Hausdach, wird ein Kopf eingezogen.
Ob hier alles weniger dreckig ist, ich selbst eingeschlossen? Ich sitze (wieder einmal) im Garten der Eltern, mit Taube und der üblichen Katze und schreibe, was ich seh.
Spitzwegerich und Breitwegerich, zum Beispiel. Wenn Sie eine Bremse beißt, eine Gelse sticht, dann zerdrücken Sie das Kraut ein wenig und verreiben den Saft auf dem Dippel. Soll helfen. So geschehen heute, beim Wandern mit Eltern und Bekannten, im sauberen Stodertal neben dem klaren Wasser der Steyr. Der Bremsenbiss lässt mein Handgelenk etwas anschwellen, was die Suche nach dem einen oder dem anderen Wegerich auslöst, ich fühle mich wie ein umsorgtes Kind, was passt, denn heute bin ich die Jüngste. Den Rest des Beitrags lesen »
Alles katzt heute
10/06/2010
Oder: Das Band, das Band, an meiner Hand …
Jetzt wird alles ruhiger, die Sonne ist fast ganz weg. Die Katzen auch. Darunter die eine, die an nackten Zehen kaut, wenn man sie lässt. Ein paar Schwalben sicheln sich noch durch den Himmel. Mücken umzingeln den Tisch, die Blumen schließen für die Nacht. Eine Amsel lärmt quer durch den Garten, und über mir fliegt etwas, das wie ein Reiher aussieht, vorsichtig ostwärts, als täten die Flügel weh. Vorhin, im Abendsonnenschein, noch zum Bruder geradelt, durch dessen Zaun gespäht, keiner daheim außer den Molchen im Teich und den Wasserläufern auf dessen gründunkler Fläche, und wieder zwei Katzen, die sich vor mir auf den Boden werfen. Alles katzt heute.
Langsam, langsam nach Hause. Verwunschene Welt. Zurück zu den Eltern, kurz zwischen den Feldern Halt gemacht, stehen geblieben, dem Weiden-Schneefall zugesehen, dem langsamen, stillen Sinken der Weiden-Watte gelauscht, im Gegenlicht, versucht, das zu fassen und gewünscht, es möge drinnen in einem auch so aussehen, so langsam und still und licht und warm und wattig.
Und jetzt, im Garten, kurz vor dessen Betriebsschluss. Beobachtet von einer fremden Katze, die mit untergeschlagenen Pfoten im hintersten Eck lagert, es ist die „hässliche“ (wie mein Vater sagt), wir kennen sie nicht so genau. Das Lederarmband am linken Handgelenk stört fast gar nicht beim Tippen.
Das Armband trage ich seit ein paar Tagen, gekauft in Wien, danach gleich ein zweites gekauft für die Schwester, weil mein Armband hat eine Botschaft (das der Schwester eine andere), an die es mich erinnert, wenn ich hinsehe, wenn ich es anlege, wenn ich es spüre und dann auch am Abend, wenn es vom Arm genommen wird. Das funktioniert. (Ein kleiner Mückenschwarm zentriert sich vor dem Bildschirm, zerstreut sich und kommt wieder.) Es sollte ja um das Lederband gehen in diesem Text, und darum, was es mir immer wieder sagen soll. Nur drängt sich jetzt der Garten dazwischen.
Wir haben Zeit. Hinter mir blüht ein Topf voller Margeriten, und ich muss immer hinsehen, weil die Farben weniger werden, aber es finden sich noch welche. Das Weiß und Gelb der Margeriten, dunkles Blaulila der Leberblumen (wenn die so heißen), sattes Lilalila einer Wickenart und das siebenfärbige Rot der Fuchsien. Ein grüner Salatkopf, der blaue Plastikpool und die gelben Kugelstrauchblüten. Es gab auch noch einen glühenden Wolkenfinger, in die Sonne gestreckt, aber der ist jetzt weg. (Die Katze ist noch da.)
Mein Handy liegt auf dem orangen Tischtuch, das werde ich bald zusammenfalten, und, klein-geachtelt (es ist kreisrund), mit dem Sessel bei den Rädern verstauen. Dort ist auch der Rasenmäher und das Werkzeug und ein kühler Grasgeruch. Früher war das eines der Tischtücher unseres Gastgartens, da war das Wirtshaus noch in Betrieb, und der Tisch stand mit anderen Tischen unter der Pergola zwischen Oleanderbüschen. (Die Geräusche werden auch spärlicher, dafür die Mücken mehr. Die Nachbarin werkt im Garten und summt dabei.)
Damals war mein Sohn noch klein. Einmal ist er im Gastgarten gestolpert und hat sich nah am Auge ein wenig weh getan. Ich nahm ihn in den Arm, und weil es geblutet hat und wir uns Sorgen machten, sind wir nach Wels ins Krankenhaus gefahren. War dann nichts Schlimmes. Es gab Schlimmeres. Etwa den Unfall mit seinem Vater ein paar Jahre später, unverschuldet, mit viel Glück von beiden fast unbeschadet überstanden.
Ich zupfe dem geschlossenen Sonnenschirm ein paar Falten zurecht. Es wäre einfach, das Handy zu nehmen und ihn anzurufen, also meinen Sohn, der sich vor gut 18 oder 19 Jahren nah am Auge verletzt hat und dann einen schlimmen Unfall überstanden hat und noch anderes, ein Mal war die Hand eingegipst, dann waren da die Schulen und die Lehre und die Sehnsüchte, und ich könnte ihn schon anrufen, aber ich tu es nicht. Hier, im Garten, der seine Farben und Geräusche abdämpft und in den Schatten hinter der einen Solarsteckleuchte tritt.
Mein Vater hat die Hecke übrigens ganz bucklig geschnitten. Ich mag das. Und gestern, als ich meine Mutter nach dem Gelsenstecker fragte, synchronisierte ich perfekt und spontan ihre übliche Antwort: Es gibt doch noch gar keine Gelsen.
Der Himmel wolkt. Es ist ganz windstill. Und natürlich rufe ich meinen Sohn nicht an. Er ist in Wien geblieben. Er arbeitet, er lebt, er macht. Ich trete einen Schritt zurück. (In den Weiden-Watte-Schneefall zwischen den lichten Bäumen.) Das ist, als würde man eine zentnerschwere Tür öffnen wollen, einen kleinen Keil hineintreiben, damit sie offen bleibt, und den Spalt dann vergrößern, nach und nach. Ich möchte. Ihn endlich aus dieser Mutterklammer entlassen. Das erdrückt uns beide. Und deswegen, und weil er es sich verdient hat, und weil ich es mir verdient habe, dieses sauschwere Loslassen, sagt mein Armband mir (jetzt kommt’s raus): Ich habe einen erwachsenen Sohn.
Immer wieder. Bis es mir ganz klar geworden ist. Und ihm auch. Wie sonst soll das gehen.
Ich starre in den dunklen Garten. Die Katze ist weg. Sie raunzt beim Nachbarn. (Ich nehme an, dort ist mehr los.)
Zwischen uns
28/02/2010
Jahre und nichts
A. sitzt mir gegenüber. Am anderen Ende des Raumes, auf dem Teppichboden, wie ich den Rücken an die Wand gelehnt. Wir sagen nichts, wir sehen uns an. Wir sehen in uns hinein, ernst, ruhig, jeder für sich. Das möchte ich. A. war aus der Welt und jetzt ist er wieder in ihr. Er war verschwunden. Im Regal steht ein Bild, das er mir geschenkt hat. Wann, weiß nicht, vor vielen Jahren. Eines dieser persischen Bilder, eine gemalte Miniatur, reitende Krieger. Wo ich hinzog, war das Bild bei mir. Anfangs noch mit A. behaftet, dann einfach nur etwas. Aus der Vergangenheit. Die es nicht gibt, diese Vergangenheit, die sich im Grunde neben uns erstreckt und zwischen uns dehnt und das Weltall aus den Angeln kippt, wenn plötzlich, nach so langer Zeit, jemand wieder in deine Welt kommt, und glauben Sie, das war heftig, als ich das Mail im Posteingang fand: Bist Du das, stand da, bist du diejenige, welche? Damals, im Zug von Wien nach Linz?
Damals, im Zug von Wien nach Linz, die Zigarette, die ich nicht geraucht habe, aber dafür die ersten Pistazien meines Lebens gegessen. Noch keine zwanzig, noch alles neu, grad die Zeit, wo man pure Kraft ist, wo unter der Haut nichts ist als Muskeln und Energie und dazwischen ein See gemischt mit Traurigkeit und Lebendigkeit im Verhältnis 1:1, die Lebendigkeit lässt dich jubeln, und die Trauer, diese alte Seele, lässt dich innehalten und schauen und spüren, so weit ist alles, so weit. Dir sitzt im Abteil ein junger Mann gegenüber, der vor Heimweh vergeht, trotzdem in Wien studiert, aber. Eben auch jemanden braucht, an dem er sich festhalten kann. Du bist jung und kraftvoll, sagst: Halt dich nur, an wem sonst, wenn nicht an mir. Weil, die Neugier macht dich ganz unrund, mit schiefem Kopf schaust du den Fremden an, der Jagdinstinkt geweckt, deine Sammelleidenschaft, wenn du ehrlich bist, hat das früh begonnen, dieses Sammeln von Menschen, die besonders sind.
Besonders. Wir schreiben uns, besuchen uns, Bilder flackern auf, seine Hände beim Kochen, das Joghurt zum Reis und nichts ist zwischen uns als Zuneigung und Achtung. Dann kommen die Briefe aus Deutschland, später aus dem Orient, das mit arabischen Schriftzeichen bedruckte Kuvert auf dem roten Tischtuch, auch so eine Erinnerung. Zwei, drei Jahre lang, ich werde Mutter, er studiert in seiner Heimat, schreibt eines Tages: Ich werde heiraten. Kleine, mit Spitzen umhäkelte Deckchen für seine Frau als Hochzeitsgeschenk, sorgfältig verpackt, ein Brief mit guten Wünschen, das wäre doch, denke ich mir, das Ende seiner Einsamkeit, die Ankunft dort, wohin er sich gesehnt hat, und dann wird es still um ihn und um uns.
Das Bild zieht mit, ein kleiner Kern A. zieht mit, wohin auch immer, die Freundschaften kommen, manche verblassen, die Lieben kommen und gehen, mein Sohn wird groß, die Muskeln unter der Haut sind nicht mehr aus Stahl, dafür aber echt. Das Verhältnis von mit Trauer gemischter Lebendigkeit verändert sich mehr oder weniger, im Grunde bleibt es gleich. Noch tiefer, noch ruhiger, und das Sehnen rüttelt dich nicht mehr ganz so unverhofft aus der Spur. Meistens.
Allerdings. Wenn dann jemand, der aus deiner Welt war und, fast fünfundzwanzig Jahre später, unvermittelt wieder mitten in deiner Welt ist, du öffnest das Bild im Mail-Anhang und mit dem Bild steht dieser junge Mann vor dir, hinter dem grauen Bart und den grauen Haaren steht dieser junge Mann und sieht dich an – wow, das ist wie ein Zeitsprung, und in dir klickt sich wieder die an die Oberfläche – diejenige welche – die du ja auch warst und im Grunde immer noch bist, die mit den harten Muskeln direkt unter der Haut, die mit der immensen Kraft und dem Hunger nach Leben und Weite und den weitoffenen Armen, groß genug, um fünf Welten zu umfassen, ja, genau die.
Dann staunst du. Oder? Und sehnst dich und wunderst dich über das Sehnen. Nein, du wunderst dich nicht darüber. Sondern, wie gut man das zur Seite schieben kann und wie unerträglich gut es sich anfühlt.
Deswegen. Kommt es mir so vor, als würden A. und ich im selben Raum sitzen. Jahre zwischen uns. Nichts zwischen uns. Und uns ansehen. Ruhig. Sein ernstes Gesicht auf meinem und meines gespiegelt in seinem. Im Ansehen betrachten wir uns selbst, erkennen die eigenen Gedanken im anderen.
Draußen das wütende Heer
15/12/2009
Unterm Dach und im Keller
Nackt könnte man sein. Das Haus schläft noch tiefer als sonst, ihm reicht ein Atemzug alle paar Tage, ein Blauwal am Meeresgrund und du in seinem Herzen. Die Wilde Jagd zieht übers Land, draußen das Wütende Heer. Drinnen, da Raunacht ist, das rituelle Räuchern. Sanft. Besänftigend.
Du stehst da, im alten Bügeleisen glüht noch Kohle, Weihrauchkörner glimmen. Ein Jahr um, gibt nichts Neues zu schreiben. Gilt, das Alte immer wieder zu schreiben, weil es wahr ist. Hier im Keller könntest du nackt sein und allein, wirklich allein. Die vielhundertjährigen Mauern wölben sich über dir, und in dir wölbt sich auch etwas. Spinnweben bewegen sich leicht im schweren Rauch.
Später als sonst bist du heuer gekommen und hast dich nicht über die Angst gewundert, die mitkommen will auf dem langsamen Gang durch das leere Haus. Ist schon Nacht, du bereitest alles vor. Die Glut, den Weihrauch. Dich. Früher, als du noch ein Kind warst. Da waren Seelen, die flüsterten. Etwas schlich vor dir über die Holztreppen und schlüpfte in Nischen, wesenlos an kalte Wände gedrückt. Heute hält sich Kinderangst an deiner Jacke fest. Während du alle Zimmer durchwanderst. Die Stille ist dicht und kühl. Sie hebt sich kurz, wie ein Tuch, und sinkt hinter dir wieder zurück.
Du bleibst im alten Wirtshaussaal vor dem Bild der Großmutter stehen. Ihre Augen sind die deinen. Du greifst ein wenig zu ihr hinüber. Hinüber oder zurück. Das Kinderzimmer mit dem Fenster zum Dachboden, der hohe Dachboden selbst. Du bist dir sicher, nicht allein zu sein. Trotzdem, bleib da. Versuche, ruhig zu werden, denkst du. Egal, was dich aus den Schatten im Gebälk beobachtet.
Und dann gelingt das auch. Immer an dieser Stelle. Das Bügeleisen raucht vor dir auf dem steinernen Boden. Alles, was je in diesem Haus gelebt hat, ist leises Gespinst, flüchtig vorhanden. Die Geschichten der Großeltern, die Franzosen, die hier interniert waren mit ihren grauen Soldatenröcken. Der Nazi, der aus einem der Fenster die Großmutter mit einer Pistole bedrohte, als sie über den Hof ging. Der Mann, der sich zur Weihnachtszeit umbringen wollte, aus Kummer, von den Seinen getrennt zu sein. Ohne Hoffnung. Die vielen Familien, die sich die Zimmer teilten. Die Onkel und Tanten und der Hund Jumbo, der beste Rattenfänger der Stadt. Es gab noch Schweine im Saustall und Kraut in der Krautkammer und Verstecke für geheime Vorräte, die mein Vater und seine Brüder besorgten.
Das war vor deiner Zeit und ist doch deine Zeit, durch die Geschichten am Stammtisch, die Erzählungen der alten Männer beim Schnapsen, und damals gab es ohnehin nur den Krieg für die einen und das Durchkommen für die anderen. Aber heute steht das Geisterreich offen in unserem leeren Wirtshaus. Der Großvater hatte es in den Dreißigerjahren gekauft, weil seine Frau das so wollte. Zugereiste waren sie, er verdiente früher in Salzburg als Küchenchef mehr als ein Hofrat, hieß es. Hier, in der Kleinstadt, blieben sie und ihre Kinder (auch die später geborenen) immer irgendwie Zugereiste, und das war auch gut so.
Das machte dir das Weggehen leichter. Waren nur mehr wenige der dünnen Wurzeln übrig für dich. Aber die sind zäh, im harten Erdboden des Kellers vergraben. Wo du jetzt stehst, wie jedes Jahr, älter, und immer noch gruselt es dich ein wenig, wenn sich Modergeruch mit Weihrauch vermischt. Die Granitsteine glitzern im dünnen Licht, und wenn du mit nassem Finger über sie streichen würdest, würden sie nach Salz schmecken. Ganz, ganz still ist es hier unten, im Innersten der Angst, die im Grunde keine ist. Oder?
Wie voll muss die Vergangenheit sein, dass du immer wieder in sie zurückkehrst. Wie dichtgewebt. Hält dich das auf oder hält dich das aufrecht? Deine stolze Großmutter, wie gern wärst du wie sie. In deinem Sohn erkennst du den Eigenwillen des Großvaters, ein wenig von dessen Unnahbarkeit. Genug, um zu wissen: Da setzt sich etwas fort.
Ist das gut? Das Haus schläft. Nackt könntest du hier stehen, nichts würde passieren während deiner Reise zurück. Die Wilde Jagd, das Wütende Heer zieht übers Land und tobt sich aus. Ja, das ist gut so. Diese Fülle ist dein Reichtum, diese Schwere dein Anker. Prall soll es sein, das Leben.
Es genügt jetzt. Ein Mal im Jahr darf man so fühlen, darf sich etwas wiederholen. Du gehst noch durch das dunkle Vorhaus in den Hof bis zum Tor und stellst das Bügeleisen im Freien auf den Boden, an einer sicheren Stelle. Das Erlöschen der Glut wartest Du ohnehin nie ab.
Muscheln und Steine
15/11/2009
Man trägt Getöse durch die Stille
Wieder sollte es ruhiger sein. Was treibt, ist die Sehnsucht, was bremst, ebenso. Ruhig geht man durch die Straßen, durch den Morgen, den Schlaf im nachtschweren Nacken, grau innen und grau außen mit schwarzen Rändern. Die sich auflösen sollten, denkt man und dann gleich: Bitte nicht. Bitte nicht auflösen, weil in einem töst es grell, in orangegelben Farben, die drängen sich unter der Haut und machen beides, warm und unruhig. Man trägt Getöse durch die Stille. Nicht umgekehrt sich selbst still durch eine laute Welt.
Ich warte auf einen Freund, jetzt, am Abend, im Cafe Ritter, bald wird er kommen. Wir werden darüber sprechen, wie es uns geht, vor allem, wie es ihm geht. (Ich versuche, mich auf diesen Text zu konzentrieren, der ungeduldig neben mir steht und sich nicht einfangen lassen will. Seit die Abstände zwischen den Kolumnen so groß sind, fällt das Schreiben nicht mehr so leicht, vorher war es ein leises Auf und Ab, eine Wellenbewegung am Strand, ein innerer Moll-Ton, der kam und ging und nie ganz weg war. Das hat sich verändert. Ich warte auf den Bus, der mich zum Strand bringt.)
Jetzt. Bin ich auch Studentin, mein Sohn ist groß und ich packe noch mehr in mein Leben, will noch mehr von diesem grellen Getöse, weil, das ist das Geheimnis: Ab und zu wird es mitten drin ganz still. Das ist die Essenz, die Potenz der Stille und wer die kennt, will mehr. Vor allem ist das ein Teil der Fülle.
Wenn der Freund kommt, wird er Kopfhörer tragen und einen leicht zugespitzten Mund, oben die Schultern angehoben und unten mit großen Schritten das Lokal durchmessend. Er wird die Hände in den Taschen haben, und bevor er mich zur Begrüßung auf die Wangen küsst, kurz nach links oder rechts schauen. Dann wird er „Mm“ machen, ein ganz kurzes, abgehaktes, sehr liebes „Mm“, eher hoch, obwohl er keine hohe Stimme hat. Aber das macht er immer so. Damit meint er vielleicht, ich will dir nix Böses. Danach hat er einen schmalen Mund.
Immer, wenn ich aufblicke, verändert sich das Bild. Vorhin saßen drei Männer schräg gegenüber, nun sind daraus zwei Frauen geworden, beide mit dicken Pullovern und Pferdeschwanz. Daneben sitzt eine alte Frau mit rosa Pullover, grauer Igelfrisur und einer Brille auf der Nase. Sie liest und notiert. Der Ober serviert ihr etwas, das auf die Distanz wie ein Beuschl mit Knödel aussieht.
Das aßen bei uns im Wirtshaus die Männer beim Frühschoppen. Ein kleines oder großes Beuschl, Würstl mit Senf, Kren, einen Einspänner, Debreziner. Wir kannten die Männer schon, und ihre Frauen, die an einem eigenen Tisch saßen, und mussten nicht mehr fragen. Das war auch Familie. Damals, im Faltenrock Teller durch das Gastzimmer jonglierend, damals waren die Farben hell und warm, die Gerüche und Düfte, es roch nach Kaffee bei der Schank und nach Bier, aber diese Erinnerung ist verblasst. In der Küche züngelte Feuer im alten Herd und folglich roch es nach Holz, wenn gerade nicht gekocht wurde. Ich überlege, ob das damals schon so war, mit dem inneren Lärm. Mein Problem war eher, Strumpfhosen ohne Laufmaschen zu finden, rechtzeitig zum Frühschoppen fertig zu sein und wieder nicht gelernt zu haben.
Ich muss mich beeilen, der Freund wird bald kommen, bis dahin sollte der Text fertig sein, der wohl mehr eine lose Sammlung ungewaschener Muscheln und Steine ist, mit Sand vom Strand dazwischen. Wenn wir geredet haben, wenn wir uns verabschiedet haben und nach Hause gegangen sind, wenn wir geschlafen haben und, mit den Resten der Nacht im Nacken, durch die kühle Stille des Morgens gehen. Was dann? Nichts. Grelloranges Getöse eben, Graffiti hinterm Solarplexus, Beats und Drums und wirklich laute Rhythmen und mitten drin ein stiller Fleck. Gut so. Ohne das wäre alles nichts.
Später, nach Mitternacht. Der Text ist nicht fertig geworden, aber zwischen vorhin und gerade eben, wo ich zuhause sitze, haben wir die Stadt angemalt, die Bäume blau, die Wände grün und den Himmel über uns, diesen dunklen, auskragenden leeren Himmel, mit sattem, tiefen Violett.
Langsam wird es ruhiger in mir und ein Nichts breitet sich aus im Raum, ein Nichts, in dem man gut schlafen kann, nachdem man noch eine Weile gelauscht hat, die Hand auf dem Bauch, auf die Geräusche von draußen, von der Straße, den Nachbarn, die durch ihre Zimmer wandern, Türen öffnen und schließen, leise Schritte. Und umgeben von diesen guten, lebendigen Geräuschen trägt man sich dann schlafend und still dem Tag entgegen und der Sehnsucht und dem, was einen drängt und treibt.
Flieg, Dostojewski, flieg!
15/08/2009
Am Ende ist nichts geordnet
Ich nehme. Meine Bücher, meine Bänke, meine Polstermöbel und werfe alles auf die Straße. Der Tisch fliegt hinterher, ein Drachen aus Holz, dem das Segeln nicht gelingt. Ich nehme. Die Bildung, die ich nicht habe, die Wörter, die mir fehlen, die Geduld, die sich verbirgt. Und stelle alles, in Müllsäcke verpackt, vor die Tür.
Draußen warten Bettler und Insekten, leere Plastikflaschen und Suppendosen, halbgeöffnet.
Ich nehme. Dich. Mitten im Zimmer lass ich dich stehen. Setze mich dann auf den Boden, an die Wand. Meine Hände fassen in den Staub von vielen Jahren, am Ende ist nichts rein, nichts geordnet. Was macht das für einen Sinn, wenn man nur von unten schreiben kann?
Draußen raschelt es, Bettler haben die schwarzen Säcke geöffnet, finden die Wörter. Probieren deren Geschmack am Gaumen, wie den von Wein oder Schnaps. Der eine sagt: Obsolet! Der andere: Quadratur! Und der dritte schweigt, weil er sich nicht traut.
Gestern saßen wir am Abend mit Freunden im weiten Gastgarten, nebenan drängte sich ein Pärchen aneinander, unübersehbar sehr verliebt. Ein hübsches Paar, recht jung und schlank. Er drehte sich zu uns um mit einer Frage. Sie wollten berechnen, sagte er, wie viele Gelsen es brauchen würde, um einen Menschen auszusaugen. So, dass er daran stirbt. Wir lachten und diskutierten sofort: Wie groß kann die Menge sein, die eine Gelse pro Stich entnimmt? Und der Stich selbst, der geht ja nicht tief. Also verbluten?
20.000 Gelsen! Das hätten sie so berechnet, sagte später der junge Mann vom Nebentisch. Nahm sein Mädchen und löste sich auf mit ihr in der warmen Nacht. Wir sahen ihnen nach, jeder für sich, die Köpfe geneigt. Natürlich stimmt die Rechnung und wehe, Sie sagen: Nein, kann nicht sein. Es ist ganz egal.
Meine erste große Liebe kam mir in den Sinn, vor 23 Jahren, wir saßen uns in einem Wirtshaus in Urfahr gegenüber und leuchteten. Er, groß, rothaarig und schön, mit einem Lächeln, ich sage Ihnen, unbeschreiblich, fütterte mich – ich konnte nicht essen vor lauter Gefühl. Die Leute bedachten uns mit netten Blicken. Wir waren das Zentrum der Welt und liefen, Hand in Hand, über die Brücke durch das nächtliche Linz.
Den letzten Zug hatte ich verpasst, das gab ein Donnerwetter am Morgen vom Vater, obwohl nichts geschehen war. Natürlich war alles geschehen, aber eben das eine jene nicht. Das eine jene kam erst später.
Mysterium, flüstert der dritte Bettler draußen, und räuspert sich. Bettler eins und zwei applaudieren dezent mit ihren fingerlosen Handschuhen, weil das ist wohl das schönste Wort im Mistsack. Die Insekten haben sich in einer leeren Dose versammelt, dort kriechen sie sich über Beine und Panzer und sagen: Ach, geben Sie doch Obacht, sehen Sie denn nicht, Sie stehen auf meinem fünften Fuß und knittern mir die Fühler, das macht mich ganz nervös!
Du hast dich neben mich gesetzt. An die kühle Wand gelehnt lauschen wir dem Rascheln von Chitin, dem Reiben winziger Flügel. Lauschen unserem Gleichklang. Jetzt grad müsstest du mich füttern wie der Rothaarige damals, ich könnt wieder nicht essen vor lauter Gefühl.
Später werden wir die Dose sacht mit einem Blatt Papier verschließen und in den Park hinübergehen, wo Insekten wohnen sollten.
Auf der Straße stehen mein Tisch und meine Bänke, beleidigt vom Fall, aber berauscht von der Sonne. Die Bücher liegen faul in der Gegend herum, ohne Scham geöffnet. Und weil man nie genug haben kann, und weil der Abendhimmel so weit ist über den Häuserschluchten, nehme ich eines und werfe es hoch in die Luft: Flieg, Dostojewski, singe ich, flieg!
Die Bettler biegen um die Ecke. Der erste schleppt einen Sessel, der zweite eine Bank. Auch den schwarzen Mistsack haben sie dabei, der dritte Bettler trägt ihn fort.
Wir sind Schweine
15/04/2009
Gebt mir Vulkanausbrüche und große Kometen
Auf der Suche nach einem windstillen Platz. Durch Wien getrieben, den Bus angestarrt, eingestiegen. Im alten AKH liegen Frauen in der Wiese, barfuß, sonnen ohne Sonne. Die zieht sich Wolken vors Gesicht. Kein Regen. Aber der Wind, man kann nicht auf Bänken sitzen, ohne zu frieren. Weiter, die Strudlhofstiege wird renoviert. Eine Holzstiege führt nebenan bergauf, bergab.
(Ich möchte mich in mich vergraben. Ich möchte weglaufen. Wegziehen. Ich möchte die Faust in fremde Lebern stoßen, Schmerzen erzeugen, Ellbögen in Seiten rammen, in hastiger, eckiger Bewegung. In Kniekehlen treten, mit Wucht nachschlagen, Wunden schaffen, Verwunderung. Dabei ziehe ich mir die Kappe tiefer über die Augen, senke den Kopf und starre auf den Boden. Während ich der Wut nachlausche, die verhallt, nachhallt, nachdröhnt.)
Wir sind Schweine. Meinte eine Frau. Sie schob mit einer Hand einen Kinderwagen, mit der anderen trug sie etwas. Das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Diese Schweine, sagte sie zu der oder dem am anderen Ende, stellen das Auto mitten auf den Gehsteig, man kann nicht vorbei. Wir hörten ihr zu, sahen sie kommen. Dass der Umzugswagen unseres Freundes ungünstig stand, wussten wir auch. Eine Viertelstunde Zeit. Um den Mietvertrag zu unterschreiben. Wir warteten auf ihn, den Autoschlüssel in der Hand. Bereit, wegzufahren. Oder vorbei zu helfen. Viele Leute gingen vorbei. Platz genug. Nicht für die Frau, die uns mit Kind, Kegel und Handy unterm Kinn großspurig und breitgoschert umrundete. Uns Schweine.
(Ich wollte. Ihr das Telefon von der Schulter reißen. Es gegen die nächste Hausmauer schleudern, zertreten, zerstören, den pseudobiologischen Schwachsinn aus ihrer Einkaufstasche auf Kühlerhauben verteilen, Joghurtbecher zerquetschen, Obst auf ihren ethisch-korrekten Stofffetzen zu Brei verarbeiten, meine Wut auf ihr auskotzen, meine unpackbare Wut in ihr dummes Gehirn brüllen, hässlich sein, ich wollte so hässlich sein wie irgend möglich und mich dann an den sonnenwarmen Stein lehnen, bis das Beben nachlässt, in ein Zittern vergeht, verweht und ich wieder schnaufen kann.)
Aber, natürlich. Stellte ich nur die Frage, ob wir wirklich Schweine wären. Während Sie dem Wagen auswich und uns durch meine Frage erst bemerkt hatte. Ja, das wären wir. Mein Freund schickte ihr gelassen etwas Passendes nach, ich bebte an seiner Seite. Für mich.
(Gebt mir Lava, gebt mir Macht. Gebt mir Vulkanausbrüche und große Kometen.)
Vorhin im alten AKH. Zwei Botero-Frauen liefen schnaufend vor sich selbst davon. Unabhängig voneinander. Sie hielten sich an den Rändern der Gebäude. Einer hatte die Anstrengung kreisrunde Flecken auf den Wangen gemalt. Frauen laufen oft so in sich verzwickt. Peinlich berührt. Mit weißen T-Shirts und schwarzen kurzen Hosen und was weiß ich im Ohr. Die Schuhspitzen nach außen.
Im Billa beaufsichtigte ein kleines Mädchen zwei noch kleinere Mädchen beim Eiskaufen. Da musst du dies und du musst das und wie viel glaubt ihr, bekommt ihr zurück? Soll ich das Eis aufs Band legen? Nein, du wartest jetzt. Bis Platz ist. Dann legst du es ganz vorsichtig hin. Jetzt. Du nicht. Schnell. Die Größere tat, als hätte sie Macht, die Kleineren taten, als würden sie der Größeren Macht geben.
Als ich in dem Alter war, gab es ein Teppichgeschäft in unserer Straße. Die Besitzer waren nett. Sie hatten eine Dackelhündin. Wir durften mit ihren Welpen spielen. Ich taufte einen davon Moritz, ging mit ihm spazieren. Einmal, und das steht noch überdeutlich in meiner Erinnerung, wisst ihr, dort, wo man vom Schlossplatz zum Mittergraben hinuntergeht, neben der Bezirkshauptmannschaft, dort, bei der kleinen Mauer.
Dort schlug ich dem Hund ein wenig mit der Leine über den Rücken. Wenn ich das tat, winselte er. Stemmte sich mit seinen Beinchen an mir hoch, wedelte, entschuldigte sich für etwas, das er nicht getan hatte. Dann herzte ich ihn. Um ihn dann wieder zu schlagen. Ich schäme mich heute noch.
Oder? Vielleicht sage ich das auch nur, um meine Ruhe zu haben. Wut ist nicht gesellschaftsfähig. Wie war das mit dem Verhalten, dem Wesen und dem Charakter? Das eine prägt, das andere wird unterdrückt.
Ach. Ich werde meinerseits die Laufschuhe anziehen, meine alten, ausgelatschten Laufschuhe, meine schwarzen Laufhosen, mir mit lauter Musik die Ohren vollstopfen und vor mir weglaufen. Oder zu mir hinlaufen. Aber nicht verzwickt. Nicht im weißen T-Shirt. Ich will, dass ihr meine Muskeln seht.
Das Unding Zeit
15/01/2009
Nimm mich mit auf die Reise
Die Zeit, dieses Unding, könne man sich vorstellen als etwas Körniges. Ein Granulat mikrowinziger Teilchen, unregelmäßig, ohne Norm. So, so ähnlich oder ganz anders. Nichts verstanden beim Zuhören, allein das Bild blieb hängen vom Körnigen, das uns umgibt, nach vorne, nach allen Seiten, rückwärts gewandt, nach innen – wir sind verdichtete Zeit.
Moleküle sind wir. Myriaden Einzelteilchen, Fischschwärmen gleich, die, aus der Distanz betrachtet, eine Form ergeben, ein Formenspiel, und sich beim Annähern verlieren in sich selbst.
Mein Freund liegt neben mir, schläft, ich stelle mir vor, wie Zeitmoleküle ihn umschweben, sich mit seinem Atem heben und senken, jede Bewegung heftig umwirbelnd, um wieder zur Ruhe zu kommen, den tiefen Schlaf beschwerend, irrlichternd im Traum.
Ich bin wach. Statt zu schlafen, liege ich mit offenen Augen und spüre den Minuten nach. Nacht für Nacht, seit einigen Tagen. Wiewohl der Körper stillhält und sich in die Tiefe ziehen lassen würde, bereit, in dunklen Ozeanen zu treiben, in ruhigen Spiralen: Das Denken zerrt nach oben; und statt die Augen zu schließen, starre ich in die Luft.
Drei Uhr, Stunde des Wolfs. Ein Wolf streift durch das graue Zimmer, und das graue Zimmer bin ich.
In der Schule lernten wir von den Atomen, aus denen alles besteht, kindliche Bilder zeigten Kern und das ihn Umsausende, dazwischen leerer Raum. Alles, was ist, hieß es, besteht aus Atomen. Langsam führte ich den Finger gegen die Wand. Ich war mir sicher, wenn man sich Zeit ließe, unendlich viel Zeit, dann könnten sich die Atome der Wand und jene des Fingers verbinden, der so in die Wand dringen würde. Wenn man nur äußerst langsam vorginge und sich vor allem auf die Zwischenräume konzentrierte, auf dieses leere Universum Raum.
Geräusche von der Straße, der Nachtbus fährt vorbei. Auf dem Rücken liegend lausche ich dem Ticken der Uhr, dem Atmen meines Freundes.
Wenn. Wenn die Zeit aus Körnern besteht. Schieben wir dann wie einen Luftpolster Zeit vor uns her? (Dieser Windhauch, der die U-Bahn ankündigt, bevor man sie hört.) Berühren wir durch unsere Vorwärtsbewegung etwas Künftiges, ehe wir von dessen Dortsein wissen? Und wenn. Wenn wir die Zeit durchmessen haben, sie geteilt haben (Schwimmer teilen das Wasser auf ihrer Bahn, schieben es hinter sich, schicken Wellen zurück an den Start), berühren wir das Vergangene?
Ich springe zwischen Jetzt und Vorher, bin wieder Kind, fasziniert von der Idee des Unendlichen, von der nach oben gewölbten Wasserhaut eines randvoll gefüllten Glases. Gäbe man winzig kleine Tropfen nach und nach zu, würde sich diese Spannung bis ins Unendliche dehnen, dachte ich, aber irgendwann müsste dennoch jener eine Tropfen zu viel erreicht sein. Aber, wenn man auch diesen wieder in Millionen unterteilte, wäre erst der Millionste Teil des Winzigen Auslöser für das Zuviel.
Natürlich war ich ein einsames Kind. Und natürlich bin ich das immer noch. Das Alleinsein ist der Raum zwischen den Kernen. (Das Maß ist voll, das Denken wölbt sich konvex.)
Der Schlaf kreist über mir, auf freie Landebahn hoffend.
Wir sprachen über die Krümmung der Zeit im Weltall, als wir zum ersten Mal ausgingen, oder krümmt sich das Weltall an sich? Mein Freund zeichnete Linien auf eine Serviette, erklärte und beschrieb, zauberte Bilder in meinen Kopf. Ich staunte über seine schmalen Hände. Wir redeten von Wurmlöchern und Quantenmechanik, von Science-Fiction und Horrorfilmen, und alles war sanft und richtig und ein Anfang.
Mein Prinz verlagert seine Position, dreht sich zu mir, legt einen Arm quer über meinen Bauch. Nimm mich mit auf die Reise, flüstere ich.
Nachtlauf durch München
15/11/2008
Ich laufe in mir mit mir mit
München, sag ich, Du entkommst mir nicht. Nachts um halb zehn zwieble ich mich ein, Laufhose, dicke Socken, T-Shirt, Jacke, darüber etwas Ärmelloses, auf den Kopf die Haube, um den Hals den Schal, in die Tasche den rudimentären Plan der Innenstadt aus der Hotellobby.
Drei Tage in der Stadt. Wenn es hell ist, im Messezentrum, wenn es dunkel ist, im Hotel. Dabei war ich noch nie in München und daher: Du entkommst mir doch nicht. Meint meine Sturheit, zieht den Schal enger und läuft los. Durchs Isartor Richtung Viktualienmarkt, dann, nach Gefühl, einfach weiter. Kalt ist es nur am Anfang. Viele Menschen. Schlendern vorbei, das Ausweichen ergibt Schlangenlinien. Andere kramen im Müll. München leuchtet gnädig.
Ich möchte die Welt wechseln. Nein, nicht so. Nicht sterben. Wenn ich sterbe, werde ich mich in Tönen verlieren, tage-, wochen-, jahrelang. In den Zeiträumen zwischen Grillenzirpen. Oder im Nebel den Atem anhalten, im Kühlen vergehen. Die Nichtmehrwange an kalte Fensterscheiben legen, die Nichtmehraugen geschlossen. Aufbrechen von innen her, ein Glückskeks ohne Botschaft, still, erwartungsfroh, hingegeben. (Soviel zu Allerheiligen.) Das ist dann.
Aber jetzt beißt die Kälte nur mehr im Gesicht. Die Straßen sind sauber. Ich laufe in mir mit mir mit. Vorbei an Kirchen, Schaufenstern, großen Plätzen, über Asphalt und Beton und Pflasterstein, anfangs huste ich ein wenig, dann tropft nur noch die Nase und ich schaue, und laufe, und laufe, und schaue.
Die Welt möchte ich wechseln. Was das heißt, kann ich – noch – nicht sagen. Ob es mit der Messe zusammenhängt, Medienmesse, viele Anzüge und Kostüme, Gadgets, Devices, aber. Etwas zerrt an mir und will den Blick nach innen zwingen, etwas anderes dreht sich weg und schaut nicht hin.
Stur muss man sein. Und streng. Erst nach zwanzig Minuten darf ich mir einen Blick auf den Stadtplan erlauben. Ich quere den Karlsplatz, halte mich am Altstadtring fest und bin überzeugt von der Richtung. Also weiter, dann doch ein Blick auf den Plan, bin völlig falsch. Nicht ums Eck, sondern quer am anderen Ende liegt das Hotel. Macht nichts, das Laufen fällt leicht, die Kälte trägt mich, ich trabe die Residenzstraße entlang, vorbei an Reichtum und Elend, an Gutgelaunten in großer Robe, an Verlorenen in schäbigen Jacken. Miststierler und Pelzausführer. Eine Frau singt in einer Passage ein leeres Lied, ein Eintonlied, und zuckt mir mit den Augen nach, in einer anderen Welt wäre sie ein Sukkubus, die weißen Hände langbefingert, der Mund blutrot und grausam.
Jeder kann ein Zombie sein. Auch die in den dicken Mänteln, tatsächlich gibt es hier Leute mit Trachtenhüten. Gut getarntes Fell, an die Umgebung angepasst. Vorbei, vorbei. München, sag ich, ich war gnädig zu dir. Wir sind uns bei Nacht begegnet, da durftest du glänzen, das Novembertaggrau weggepackt, die Lichter aufgezogen, geschmückt mit schönen Menschen, fröhlichen vor allem, und die Armen, die waren in den Passagen und unter den Bäumen im Park hinterm Isartor. Aber nur ganz wenige.
Zurück im Hotel, mein Hintern ist eiskalt, Tee, nein, Tee gibt’s keinen mehr, da müsste man ja extra die Maschinen wieder hochfahren. Ob ich nicht lieber ein Wasser trinken möchte. Passt schon, entschuldige ich mich beim Nachtportier für die Anmaßung, heißes Wasser aus der Leitung täte es auch. Die Treppen hoch. Im Zimmer schäle ich mich aus der Kleidung, friere kurz vor dem Spiegel, schau mich an. Schau in mein erhitztes Gesicht. Die Welt möchte ich wechseln. Wenn ich weiß, was das genau bedeutet, werde ich es Ihnen verraten.
Insekt unter Insekten
15/07/2008
Urlaub bei den Eltern
Bevor man sich in den Pool begibt, säubere man ihn mittels bereitgestelltem Käscher von toten und fast toten Insekten. Urlaub bei den Eltern. Der Pool ist ein aufgeblasenes Plastikrund, das Wasser brunzwarm. Also genau richtig. Ein Durchmesser von zweieinhalb Metern erlaubt das Treiben auf der Luftmatratze. Vögel singen. Die Nachbarkatzen verteilen sich im Garten. Eine, Moses, äugt unter der Hecke versteckt nach dem Monster im Pool. Manchmal taucht mein Kopf über den Rand, die Position verlagernd, vom Bauch auf den Rücken oder umgekehrt.
Weiße Streifen soll der Körper haben, braun werden und gesund.
Das mit dem Insektenfischen ist freiwillig. Ich lege den Chitinpanzer ab und tauche ins Wasser. Ich lege den Chitinpanzer ab und distanziere mich. Wien ist voll. Hier ist es leer. Luftraum. Kühle Luftpolster am Abend über den Feldern. Die Schirmkappe tief ins Gesicht gezogen, fahre ich mit dem Rad durch den Auwald. Bei der Kläranlage stinkt es nach Verwesung. Winzige Mücken kleben auf meiner feuchten Haut. Ich will nichts sehen. Ich will nicht gesehen werden. Hier ist nichts.
Mit meiner Schwester und ihrer Tochter wandere ich über Wiesen. Meine Nichte schüttelt eine Minischnecke aus ihrem Schuh. Die nächste bin ich: Mit einem Grashalm retten wir den Schneck vor meinen Zehen. Wir lachen. Gehen weiter. Der Abend senkt sich auf die Hügel. Klassisch. Und schön. Später sitzen wir in ihrer Küche, haben Kuchen gegessen. Tee getrunken. Geredet. Mein Schwager kommt heim, wir erzählen von hier, von dort. Es ist spät, meine Nichte gähnt sich ins Bett, schmeichelt sich noch an die Eltern, schmiegt sich an mich, nuschelt ein wenig (das macht die Zahnspange), bevor sie schlafen geht.
Ich schlafe im Bett ihrer Schwester, die nicht da ist. Schulausflug. Ihr Mädchenzimmer gehört mir für eine Nacht. Ein Himmel aus fluoreszierenden Sternen leuchtet im Dunkeln über mir.
Mit der Lokalbahn zurück nach Eferding. Denk dir Pinien dazu, vielleicht Olivenbäume. Der Zug zieht eine Kurve um die Stadt, bevor er sich ihr nähert. Dramen spielen sich ab, irgendwo.
Die Sonne brennt, so ist es richtig, und eine braune, haarige Raupe quert den Treppelweg an der Donau. Wird sie es schaffen, frage ich und Andrea meint, ja, das ist eh eine große. Ich schau nach hinten und nach vorn, niemand in Sichtweite. Wir skaten bis zum Kraftwerk, manchmal ein höfliches Klingeln von Radtouristen im Rücken, dann machen wir Platz. Andrea klatscht mir fröhlich auf den Po, dann fährt sie wieder neben mir. Spuckt und prustet, hat etwas Fliegendes verschluckt.
Später sind wir ausgetrocknet, schmeißen das klobige Zeugs in den Wagen und stelzen auf Beinen, die vom Rollern noch ganz durcheinander sind, in den Gastgarten. Wir trinken große Gläser Apfelsaft mit Wasser, essen Salzstangerl. Das Salz bröseln wir unter dem Tisch auf den Boden.
Ich kenne die Wirtin. War ja selber Wirtstochter. Ein Wirt kennt den anderen.
Heute Morgen haben wir einen alten Schreibtisch in ein leeres Zimmer getragen. Auf dem Tisch standen alte Töpfe, in einem krümmte sich eine tote Spinne. Früher war das hier unser Wohnzimmer. Jetzt sitze ich am Tisch und tippe den Text. Dabei kann ich aus dem Fenster sehen. Dächer, Bäume. Autos und Lastwagen, die durch Eferding fahren. Ganz hinten ein Eck vom Lagerhaus. Ganz vorn der alte Konsum. Ex-Konsum.
Im Nebenraum malt mein Neffe. Er ist so alt wie mein Sohn. Mein Sohn fehlt mir. Er ist in Wien und ich muss ihn ein wenig in Ruhe lassen. Wir haben beide unseren Panzer abgelegt.
Es ist warm heute, aber der Himmel bewölkt. Manchmal zeichnet sich ein Streifen Licht auf den Boden. Ein Eck Sonne. Ich gehe nur dann in den Plastikpool, wenn es brennheiß ist. Vorher muss ich die Insekten retten, die toten und die fast toten, die sich nicht auskennen in dem riesigen Meer. Mit dem Käscher sammle ich sie ein und schüttle sie in die Wiese. Oder in die Rosen, wenn sie noch leben.